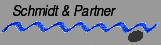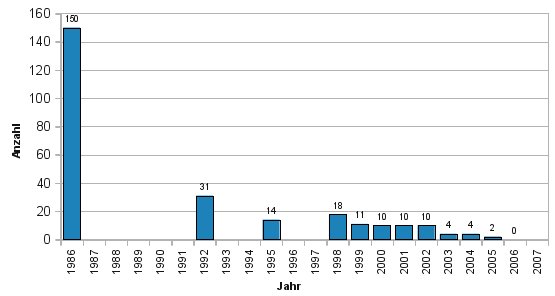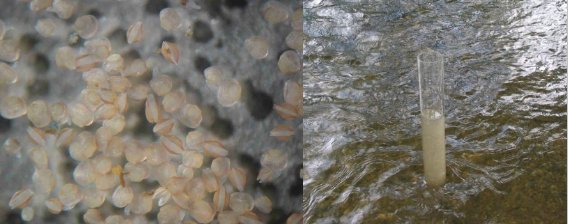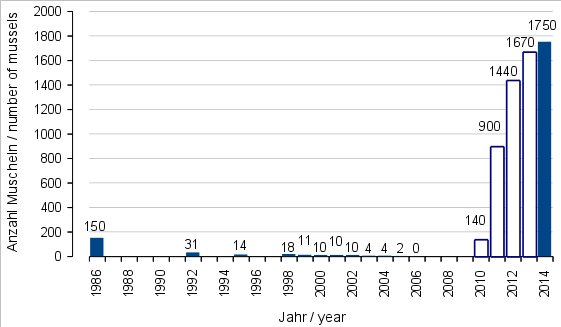|
Erste gelungene Wiederansiedelung der
Flussperlmuschel in Bayern
In einem kleinen Perlgewässer im Falkensteiner Vorwald bei
Regensburg wachsen wieder junge Flussperlmuscheln auf. Die
Altmuscheln waren Ende der 1990er Jahre
ausgestorben. Durch jährliche
Wiederansiedelungsmaßnahmen des Landschaftspflegeverbandes
Regensburg e.V. seit 2006 konnte ein neuer Bestand
begründet werden. Damit stellt das Projekt nach der Lutter
in Niedersachsen (Altmüller & Dettmer 2000) den
deutschlandweit erst zweiten erfolgreichen Versuch dar,
das natürliche Aufwachsen von Jungmuscheln in einem
Flussperlmuschelgewässer neu zu ermöglichen.
nach
oben
1. Die Vorgeschichte:
Belastungen und Sanierung
Mit unter 10 km2 ist das Einzugsgebiet des
Gewässers klein. Es ist zudem überwiegend bewaldet und
weist keine intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen
auf.
Eine Belastung mit häuslichem Abwasser bestand
früher durch ein bewohntes Forsthaus. Mittlerweile verfügt
es über eine verbesserte Klärung. Hauptbelastungsquelle
stellten bewirtschaftete Fischweiher im Oberlauf dar, die
im Jahr 1968 errichtet und im Durchfluss betrieben wurden.
In den 1990er Jahren war der Bach häufig trüb und wies im
Mittellauf daher stark verschlammtes Substrat und im
Oberlauf umfangreiche Schlammablagerungen auf (Grafe
1993). Im Jahr 1997 wurden Umlaufgerinne um die bisher vom
Bach durchflossenen Teiche geschaffen. Sie führten
in der Folge zu einer Verringerung der Gehalte an
Ammonium, Gesamtphosphat und Chlorophyll im Fließgewässer
(Theiß 1998, 1999).
nach
oben
2. Validierung der
Habitatqualität
Von 1998 bis 2004 war der Restbestand an
adulten Flussperlmuscheln von 18 auf 4 zurückgegangen.
Eine Trächtigkeit konnte in diesem Zeitraum bei keiner
Muschel mehr festgestellt werden. Damit war eine
Bestandesstützung aus dem Vorkommen selbst nicht
mehr möglich.
Wegen der als günstig angesehenen
Lebensraumsitutation wurde eine Neubegründung des
Bestandes mit Muschellarven einer verwandten Herkunft
erwogen. In einer Voruntersuchung wurde das Bachsediment
im Hinblick auf seine Jungmuscheltauglichkeit begutachtet
und vorhandene gewässerchemische Messungen ausgewertet.
nach
oben
Substratqualität
Eine ganzjährig gute Durchströmung des
Sedimentes und eine hohe Sauerstoffverfügbarkeit sind
Voraussetzung für das Aufwachsen von Jungmuscheln. Als
Indikator für die Sauerstoffverfügbarkeit im Sediment
wurden u.a. Eisennägel für drei Monate senkrecht in den
Bachgrund eingebracht. Der Sauerstoff gibt sich danach als
Rostansatz an den Nägeln zu erkennen.
Das Bild zeigt die Nägel von zwei Probestellen. Oben:
Nägel fast bis zur Spitze stark korrodiert und
rostverkrustet = sehr gute Sauerstoffverfügbarkeit. Unten:
Nägel überwiegend metallfarben-blank = kein Sauerstoff
vorhanden und stark reduzierende Verhältnisse im Sediment.
An fast allen Probestellen wurde eine gute und meist auch
tiefgründige Sauerstoffverfügbarkeit angezeigt. Ergänzende
Korngrößenanalysen zeigten eine Spanne von unverschlammten
Sedimenten bis zu stärker verschlammten Substraten an.
Insgesamt wurden über
größere Strecken günstige Substratverhältnisse für
ein mögliches Aufwachsen von Jungmuscheln indiziert.
Wasserqualität
Die verfügbaren gewässerchemischen Messungen
deuten auf eine sehr gute Wasserqualität hin. Sie halten
die von Moorkens (2000) nach empirischen Daten aus Irland
vorgeschlagenen Grenzwerte für gute, d.h. sich verjüngende
Flussperlmuschelgewässer ein. Für eine geringe Belastung
durch lokale anthropogene Quellen im Einzugsgebiet spricht
der sehr geringe Anstieg der Stoffkonzentration von
bewaldeten Quellbereichen zum Habitat der Flussperlmuschel
im Mittellauf. Vor Errichtung der Umlaufgerinne um die
Teiche hatte Theiß (1997) noch von deutlichen
Verschlechterungen gewässerchemischer Daten im
Längsschnitt des Baches berichtet.
nach
oben
3. Wiederansiedelung
Die gute Wasser- und Sedimentqualität ließen
einen Wiederansiedelungsversuch aussichtsreich
erscheinen. Seit 2006 werden in einem genetisch nahe
verwandten Bestand im Bayerischen Wald jährlich
Muschellarven gewonnen. Gleich im Anschluss an die
Larvengewinnung werden mittels Elektrobefischung im
Zielgewässer Bachforellen gefangen, am Ufer mit den
Larven infestiert und direkt wieder ausgesetzt.
Parallel werden jährlich gezüchtete Bachforellen auf
einer Teichanlage mit den Larven infestiert. Die im
folgenden Jahr von den Fischen abfallenden Jungmuscheln
werden gewonnen und an günstigen Stellen des Baches
in den Gewässergrund ausgebracht.
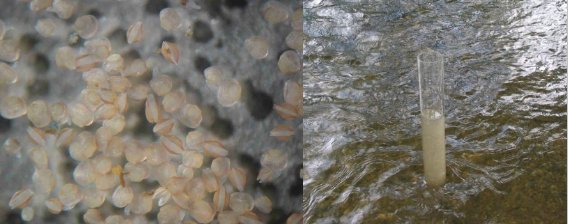
Nach zufälligen Funden einzelner Jungmuscheln bei den
Wiederansiedelungsmaßnahmen seit 2012 wurde im Sommer 2014
eine Rasterkartierung durchgeführt. Auf einer
Gesamtstrecke von 3,8 km wurden in regelmäßigen
Abständen 5m Bach abgesucht.
Die aus den Muschelfunden berechnete Schätzung der
Populationsgröße beträgt 1.750 Tiere. Die Abbildung zeigt
für die Muscheln ab vier Jahren die Entwicklung des
Bestandes, wie sie sich aus der Altersstruktur der
gefundenen Tiere ergibt (weiße Säulen).
Das Alter derMuscheln lag zwischen zwei und
sieben Jahren, wobei Tiere unter vier Jahren nur zufällig
und sehr selten gefunden wurden.
Auch die schon etwas älteren Jungmuscheln sind tief
eingegraben (links). Nur ausnahmsweise findet man Muscheln
auf der Oberfläche (rechts). Anhand ihrer Jahresringe kann
das Alter der Tiere bestimmt werden.
Die Jungmuscheln haben sich weit über die
Ansiedelungsstrecke hinaus ausgebreitet: 15 % der Tiere
wurden oberhalb und unterhalb der Bereiche, in denen
Wirtsfische und Jungmuscheln ausgebracht wurden, gefunden.
Ein Teil der Tiere wurde offenbar bachabwärts verdriftet.
Oberhalb der Ansiedelungsstrecke lebende Muscheln können
nur mit den vor Ort infestierten autochthonen Wirtsfischen
verbreitet worden sein. Dadurch ist die Wirksamkeit dieser
kostengünstigen Artenhilfsmaßnahme belegt.
nach
oben
4. Gewonnene Erkenntnisse
Jungmuscheln
brauchen hohe Anteile unverschlammter, gut mit
Sauerstoff versorgter Substrate und eine sehr gute
Wasserqualität. Die in der Literatur mehrheitlich
vertretene naturschutzfachliche Einschätzung der
physikalisch-chemischen Habitatansprüche für das
natürliche Aufwachsen von Flussperlmuscheln (Bauer 1988,
Moorkens 2000, Sachteleben et al. 2004, Geist &
Auerswald 2007) wird durch den Erfolg in diesem Gewässer
bestätigt.
Erst müssen die
Lebensbedingungen im Gewässer optimiert werden - dann
können bestandesstützende Maßnahmen Erfolg haben.
In diesem Bach können wieder junge Perlmuscheln
aufwachsen, da zuvor die Abwasserbelastung minimiert
und der Teichanschluss beseitigt wurde. „Zu den
Grundvoraussetzungen für Auswilderungsprojekte zählen
passende Habitatbedingungen und -verfügbarkeit sowie eine
genetisch angepasste Ursprungspopulation für die
einzubürgernden Tiere“ (IUCN/SSC 2013). Die
präzise Identifizierung aller Belastungsquellen und
wirksame Sanierung der Perlgewässer mitsamt ihrer
Einzugsgebiete sind die Grundvoraussetzung für eine
erfolgreiche Bestandesstützung und Wiederansiedelung der
Flussperlmuschel (vgl. Altmüller & Dettmer 2000,
Altmüller 2005). In einer umfassenden Literaturauswertung
zu Ökologie und Schutz der Flussperlmuschel weist auch
Young (2009) dem Bereich „Active catchment management and
stream restoration, often including silt reduction“ die
erste Priorität zu.
Die Voraussetzungen für die Sanierung waren am
Projektgewässer mit einem hohem Waldanteil und
überschaubaren Belastungsfaktoren ungleich günstiger als
an Gewässern in der Kulturlandschaft. Diese sind in der
Regel stärker verändert und durch Einflüsse aus der
landwirtschaftlich genutzten Fläche sowie durch kommunale
Abwässer beeinträchtigt. Dass
die Habitatsanierung auch in der Kulturlandschaft
möglich ist, zeigt das Lutterprojekt. Auch in
einigen bayerischen Kulturlandschaftsgewässern mit noch
erhaltenen größeren und nur mäßig überalterten
Perlmuschelbeständen stehen die Chancen auf deren Erhalt
gut, wenn die bestehenden Gefährdungen zielorientiert,
konsequent und dauerhaft eliminiert werden.
Methodisch waren bei der Wiederansiedelung aller
Wahrscheinlichkeit nach sowohl die Infestation von Fischen
direkt vor Ort als auch die Ausbringung geeernteter
Jungmuscheln erfolgreich. Sicher funktioniert hat die
Infestation vor Ort. Diese Maßnahme wurde auch beim
Wiederaufbau der Population an der Lutter eingesetzt. Sie
verursacht verglichen mit der Gewinnung, Hälterung und
Ausbringung von Jungmuscheln einen deutlich geringen
Personal- und Mittelaufwand. Die
Infestation von autochthonen Wirtsfischen direkt vor Ort
ist sowohl wirkungsvoll als auch kostengünstig und
erscheint daher besonders empfehlenswert.
Einen Nachweis der zitierten Literatur stellen wir gerne
auf Anfrage zur Verfügung.
|