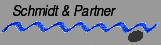|
Landbewirtschaftung an Perlgewässern
Thesen zu einer für die Flussperlmuschel
verträglichen Landwirtschaft
Christine Schmidt und Dr. Robert Vandré,
Schmidt & Partner GbR 2007

Perlgewässer-Einzugsgebiet in der
Kulturlandschaft
Flussperlmuschelgewässer: Leitbild und
Landwirtschaft
Nach dem Leitfaden Flussperlmuschelschutz
ist „die Integration einer extensiven Landbewirtschaftung
in ein
Leitbild für potenzielle Flussperlmuschelgewässer möglich.
Voraussetzung ist dabei, dass die Nährstoffbilanz des
Einzugsgebietes
zumindest ausgeglichen, wenn nicht sogar negativ ist“ (1).
Diese
Aussage soll im Folgenden überprüft und genauer gefasst
werden.
Von den Gefährdungsfaktoren der Flussperlmuschel (1) haben
die
Eutrophierung und die Verschlammung des Gewässerbetts
einen direkten
Bezug zur Landbewirtschaftung im Einzugsgebiet.
Eutrophierung
In Anlehnung an die Inventuren von Bauer
(2) und Moorkens (3) gibt der Leitfaden für die
Wasserqualität
Richtwerte von 1,7 mg NO3-N/l und 0,06 mg PO4-P/l an (1).
Bei einem
mittleren jährlichen Abfluss im Bereich von 300 bis 700 l
pro m2 in
Einzugsgebieten bayerischer Perlgewässer (nach Daten aus
(4)) bedeutet
dies, dass im Mittel 5 bis 12 kg N und 200 bis 400 g P je
ha und Jahr
als Nitrat bzw. Orthophosphat in die Gewässer gelangen
dürfen. Die
natürliche Hintergrundbefrachtung wird dabei auf 2,5 bis 5
kg N und 50
bis 100 g P je ha und Jahr geschätzt (6) (8) (15), sodass
nur unter 10
kg N und unter 300 g P je ha und Jahr als zusätzlich
tolerierbarer
Eintrag erscheinen.
Deutschlandweit beträgt der N- und P-Eintrag in die
Oberflächengewässer
aus den überwiegend landwirtschaftlich bedingten
Eintragspfaden
Erosion, Abschwemmung, Dränagen und Grundwasser 25 bis 30
kg N und
1.000 bis 1.200 g P je ha landwirtschaftlicher Nutzfläche
und Jahr (6)
(7). Auf die Gesamtfläche bezogen beträgt der Eintrag 12
bis 14 kg N
und 500 bis 600 g P. Aus kommunalen Kläranlagen stammt
noch einmal ein
viertel (N) bzw. die Hälfte (P) der landwirtschaftlich
verursachten
Menge. Die mittlere landwirtschaftliche
Gewässerbefrachtung mit P und N
liegt damit alleine über der für Flussperlmuschelgewässer
tolerierbaren
Gesamtbefrachtung. Das in (1) formulierte Leitbild kann
daher bestätigt
werden:
These 1
Landbewirtschaftung ist ein wesentlicher Faktor für die
Habitatqualität
von Perlgewässern in der Kulturlandschaft
These 2
Die Flussperlmuschel erfordert eine weit über das mittlere
Maß
hinausgehend gewässerschonende Landbewirtschaftung,
insbesondere
bezüglich der Nährstoffüberschüsse.
Verschlammung
Erosion und Bodeneintrag sind Quelle der
Verschlammung des Bachsedimentes durch anorganisches
Feinsediment. Die
Eutrophierung fördert die Bildung organischen Schlamms
durch
Algenaufwuchs. Vermutlich verstärkt die Eutrophierung auch
die
anorganische Verschlammung des Bachsedimentes durch
Bildung von
Biofilmen (9). Eutrophierung und Verschlammung sind also
direkt
gekoppelte Prozesse.
Im Gegensatz zu den modernen Nährstoffüberschüssen hat es
die
Bodenerosion auch in früheren Jahrhunderten gegeben, ohne
dass die
Flussperlmuschelbestände ausgelöscht wurden (10). Ob die
Bodenerosion
auch ohne Eutrophierung die Bachsedimente dauerhaft
verschlammen und
die Muscheln schädigen würde, ist daher unklar. Da die
landwirtschaftlich genutzten Böden aber heute
flächendeckend mit
Nährstoffen angereichert sind, führt die Erosion heute
sicher zu einer
Schädigung der Flussperlmuschel.
These 3
Die Flussperlmuschel erfordert eine bodenerhaltende, die
Erosion
vermeidende Landbewirtschaftung.
Landnutzungssysteme
Ein generalisierender Vergleich
verschiedener Landnutzungssysteme bezüglich
Nährstoffüberschüssen und
Erosion ergibt folgende Beziehungen (11) (12):
Hohe Nährstoffüberschüsse sind vor Allem in viehhaltenden
Betrieben zu
erwarten. Reine Marktfruchtbetriebe können eine bessere
Nährstoffausnutzung erreichen. Hier besteht aber wegen des
Ackeranteils
ein hohes Erosionsrisiko.
Intensive Grünlandbetriebe haben - mit Ausnahme von Ufer-
oder
Grasnarbenzerstörungen durch starken Viehtritt - kein
Erosionsproblem.
Da sie jedoch mit Fleisch- und Milchprodukten nur geringe
Nährstoffmengen exportieren, verursachen sie besonders
hohe
Nährstoffüberschüsse (>150 kg N/ha/a). Gemischtbetriebe
können über
den Anbau von Futtermitteln oder Marktfrüchten größere
Nährstoffmengen
exportieren.
Eine Verringerung der N-Düngung in Marktfrucht- und
Gemischtbetrieben
verringert die N-Überschüsse deutlich, ist aber nur durch
Subventionierung ökonomisch rentabel (14).
Ökologisch wirtschaftende Gemischtbetriebe erzielen durch
den Verzicht
auf Mineraldüngung geringere Nährstoffüberschüsse als
konventionelle
Betriebe. Durch den Leguminosenanbau können dennoch
erhebliche
N-Überschüsse entstehen (Dauerversuch Scheyern: 82 kg
N/ha/a, hiervon
allerdings 55 kg im Boden gespeichert (12)).
Eine Reduktion der Nährstoffimporte mit Futtermitteln und
Düngern bei
gleichzeitiger Verringerung des Viehbesatzes veringern die
Überschüsse
von Grünlandbetrieben deutlich. Ebenfalls deutlich
N-effektiver ist die
Haltung von Kühen mit geringerer Milchleistung bei
besserer Auswertung
geringerer Futterqualitäten. Bei zugleich geringer
Besatzdichte können
geringe Nährstoffüberschüsse erreicht werden.
Bei milcherzeugenden Betrieben führt die einseitige
Verringerung der
Stickstoffdüngung zu erhöhtem aufkommen von Klee im
Intensivgrünland.
Hierdurch wird die N-Einsparung teilweise wieder
aufgehoben. Insgesamt
wird die N-Bilanz aber dennoch günstiger.
Milchvieh bedingt bei Stallhaltung etwas höhere
N-Überschüsse als bei
Weidewirtschaft. Die N-Verluste gehen bei Stallhaltung
jedoch
überwiegend als NH3 in die Atmosphäre, während sie auf der
Weide
überwiegend als NO3 in die Hydrosphäre gelangen. Zudem
gibt es bei
Stallhaltung keine Erosionsrisiko durch Viehtritt.
Sehr geringe Nährstoffüberschüsse erzielt allein die
extensive
Viehhaltung ohne Milchproduktion, z.B. Mutterkühe, Schafe,
Ziegen,
Pferde. Das Problem hierbei ist die begrenzte
Wertschöpfung pro Fläche.
These 4
Als flussperlmuschel-verträgliche Landwirtschaft kommen
vor Allem
extensive Grünlandnutzungen mit stark reduzierter Düngung
in Frage. Bei
sehr gutem Management kann möglicherweise auch die
extensive
Milchproduktion im reinen Grünlandbetrieb oder die
biologische und
zugleich extensive Milchproduktion im Gemischtbetrieb die
Anforderungen
erfüllen. Dies wäre näher zu prüfen.
Nährstoff-Rückhaltung
Der landwirtschaftliche N-Bilanzüberschuss
beträgt deutschlandweit etwa 100 kg N/ha/a. 20% hiervon
sind gasförmige
Verluste (7). Der Rest kann potentiell die Gewässer
belasten. Der
Eintrag in die Oberflächengewässer aus der
landwirtschaftlichen Fläche
wird aber „nur“ mit 25 bis 30 kg N/ha/a bilanziert. Beim P
stehen 8 kg
Bilanzüberschuss (13) nur 1 kg geschätztem Eintrag in die
Gewässer
gegenüber. Dies illustriert die entscheidende Bedeutung
der
Nährstoff-Rückhaltung.
Als Puffer wirken Feuchtgebiete, in denen der Stickstoff
denitrifiziert
wird. Ein Rückhalt durch Speicherung im Boden findet bei N
in
organischer Form und bei P in organischer wie
anorganischer Bindung
statt. Die gespeicherten Nährstoffmengen können allerdings
später
wieder frei werden und das Gewässer noch lange Zeit
belasten. Nicht nur
N sondern auch P wird mit dem Sickerwasser weiterverlagert
(6) (15).
Stark befrachtete Bodenspeicher müssen daher durch Entzug
(Aushagerung)
rückgeführt werden.
Beim Nährstoffrückhalt ist zu beachten, dass kleine
Pufferflächen wie
etwa Uferrandstreifen nicht die Überschüsse großer Flächen
im
Hinterland aufnehmen können. Bei Hochwasserereignissen
können die
Puffer zudem durch oberflächlich abfließendes Wasser
überbrückt werden.
These 5
Eine Vernässung der Talböden von Haupt- und
Seitengewässern mindert
N-Überschüsse effektiv. Akkumulationsflächen für
abgeschwemmten Boden
können den Austrag von N und P gleichermaßen bremsen.
Langfristig wird
der Eintrag in die Gewässer aber nur durch eine
ausgeglichene oder
negative Nährstoffbilanz im Einzugsgebiet unterbunden.
Andere Stoffe
Es ist davon auszugehen, dass neben P und N
auch andere Elemente und Stoffe, die durch die Landnutzung
in die
Gewässer gelangen, die Habitatqualität für die
Flussperlmuschel
bestimmen. Hierzu zählen etwa weitere Nährelemente wie Ca,
S und K,
Pestizide, Hormone und andere Wirkstoffe, Sickersäfte,
Kraft- und
Schmierstoffe und Schwermetalle. Ein wirkungsvoller
Havarieschutz ist
wesentlich für den nachhaltigen Schutz der
Muschelbestände. Z.B.
Uferrandstreifen können dem Havarieschutz dienen.
Die Wirkung, die diese Stoffe bei sachgerechter Anwendung
auf die
Habitatqualität der Flussperlmuschel haben sind nicht
bekannt. In
erster Näherung kann aber davon ausgegangen werden, dass
der Eintrag
dieser Stoffe ins Gewässer unterbunden werden muss. Die
Maßnahmen
hierzu sind in vielen Fällen identisch mit der Verhütung
von N- und
P-Einträgen: Vermeidung von Nährstoffüberschüssen,
extensive Nutzung,
ökologische Wirtschaftsweise, Vermeidung von Erosion.
These 6
Eine extensive und ökologisch ausgerichtete
Landbewirtschaftung dient
auch der vorsorglichen Verhütung noch unbekannter
negativer Einflüsse
der Landbewirtschaftung auf die Flussperlmuschelgewässer.
Aktuelle Entwicklungen
Die Wirtschaftlichkeit gewässerschonender
Wirtschaftsweisen wird direkt bestimmt durch Programme,
Prämien und
Zuschüsse (16). Die laufenden Reformen der europäischen
Agrar- und
Umweltpolitik haben direkte Auswirkungen auf die
Möglichkeiten zur
Einführung einer flussperlmuschelverträglichen
Landwirtschaft, sind
aber in ihren Auswirkungen noch nicht absehbar (16). Eine
aktuelle
Folge der europäischen Agrarpolitik ist die Zunahme des
Anbaus von
Energiepflanzen. Da der Energiepflanzenanbau in Konkurrenz
sowohl zu
den Marktfrüchten als auch zur Grünlandwirtschaft tritt,
kann er
möglicherweise die Einführung einer extensiven
Grünlandwirtschaft in
Perlgewässer-Einzugsgebieten erschweren oder verhindern.
Literatur
(1)Sachteleben J., Schmidt C., Vandre R.
& Wenz G. (2004): Leitfaden Flussperlmuschelschutz. –
Bayerisches
Landesamt für Umweltschutz Schriftenreihe Heft 172.
(2)Bauer G. 1988: Threats to the freshwater pearl mussel
Margaritifera
margaritifera L. in Central Europe. - Biol. Conservation
45: 239-253.
(3)Moorkens E.A. 2000: Towards an understanding of the
water quality
requirements of Margaritifera in Ireland. –
Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg & Wasserwirtschaftsamt Hof (Hrsg.): Die
Flussperlmuschel
in Europa: Bestandssituation und Schutzmaßnahmen. Kongress
16.-18.10.2000 in Hof. Tagungsband: 45-59.
(4)Hochwassernachrichtendienst Bayern,
http://www.hnd.bayern.de/,
Stand: September 2007
(5)Statistisches Bundesamt, http://www.destatis.de; Daten
von 2006
(6)Behrendt H.,Bach M., Kunkel R.,Opitz D.,Pagenkopf
W.G.,Scholz G.
2003: Quantifizierung der Nährstoffeinträge in die
Oberflächengewässer
Deutschlands auf der Grundlage eines harmonisierten
Vorgehens.
Umweltforschungsplan des Bundesministers für Umwelt,
Naturschutz und
Reaktorsicherheit Wasserwirtschaft, Forschungsvorhaben
29922285.
Umweltbundesamt,
http://osiris.uba.de/gisudienste/Herata/npbilanz/bericht/deutsch/kurzfassung.pdf
(7)Bundesministerium für Umwelt, Gesundheit und
Reaktorsicherheit 2004:
Bericht der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 10
der Richtlinie
91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der
Gewässer vor
Verunreinigungen durch Nitrat aus landwirtschaftlichen
Quellen.
(8)Frede H.-G. & Dabbert S. 1999: Handbuch zum
Gewässerschutz in
der Landwirtschaft. - ecomed ? Verlag, Landsberg.
(9)T.J. Battin, D. Sengschmitt 1999: Linking Sediment
Biofilms,
Hydrodynamics, and River Bed Clogging: Evidence from a
Large River.
Microbial Ecology 37,185-196
(10) Vandré R., Schmidt C. & Wenz G. (2000):
Contributes modern
agriculture to the decline of the freshwater pearl mussel?
A historical
review. Z. Ökologie u. Naturschutz 9 (2000): 129-137.
(11) Anger, M. 2004: Möglichkeiten und Grenzen der
nachhaltigen
Bewirtschaftung von Grünlandsystemen. in:
Ressourcenschonende
Grünlandnutzung ? Erfolge, Probleme, Perspektiven ? 16.
Wissenschaftliche Fachtagung 19.Mai 2004. Schriftenreihe
des Lehr- und
Forschungsschwerpunktes ?Umweltverträgliche und
Standortgerechte
Landwirtschaft?, Landwirtschaftliche Fakultät der
Universität Bonn,
Band 130
(12) Gutser, R. 2006: Bilanzierung von Stickstoffflüssen
im
landwirtschaftlichen Betrieb zur Bewertung und Optimierung
der
Düngungsstrategien. Acta agriculturae Slovenica 87, 129 -
141
(13) Umweltbundesamt 2007: Umweltdaten online.
Kernindikatoren-System.
http://www.env-it.de/umweltdaten/public/, Oktober 2007
(14) Köhne M., Isselstein J., Barunke A., Scheringer J.,
Gerowitt B,
Osewold, S. 2001: Das Niedersächsische Pilotprojekt zur
Einführung
einer reduzierten Stickstoffdüngung in
landwirtschaftlichen Betrieben.
Bericht des Forschungs- und Studienzentrum Landwirtschaft
und Umwelt,
Universität Göttingen
(15) Bohner A., Eder G., Schink M. 2007:
Nährstoffkreislauf und
Stoffflüsse in einem Grünland-Ökosystem. 12. Gumpensteiner
Lysimetertagung, Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt
für
Landwirtschaft, Irdning
(16) Horlitz T., Bathke M., El Orfi A. 2007: Ökonomische
Bewertung von
FFH-Maßnahmen zur Ermittlung wirtschaftlicher Nachteile
landwirtschaftlicher Unternehmen Sachsens. Schriftenreihe
der
Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft Heft 14/2007
|